|
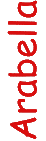
|
|
 BASLER ZEITUNG BASLER ZEITUNG
|
|
Basler Zeitung, 9. Mai 2000
|
|
Sigfried Schibli
Die Fiakermilli
aus dem Broadway-Theater
«Arabella» von Richard Strauss neu am Zürcher Opernhaus
|
| Allmählich hat man sich ja an die bequeme Unterscheidung gewöhnt: Hier der traditionelle, konventionelle, der «Werktreue» verpflichtete Opernstil, da das moderne Regietheater mit seinem manchmal produktiven, manchmal ärgerlichen Hang zum Transponieren und Neuerfinden der Stücke. Und dann läuft einem so etwas wie Götz Friedrichs Inszenierung der Strauss-Oper «Arabella» übern Opern-Weg, und man ist verblüfft: Offenbar gibt es doch auch die Synthese von beidem, den «modern traditionellen» Aufführungsstil. |
| Friedrich hat mit seinen Bühnenbildnern Gottfried Pilz und Isabel Ines Glathar die Oper, die in Wien um 1860 spielt, in die Entstehungszeit des Werks (1933) verpflanzt. Das Österreichische hat er nicht ganz abstreifen wollen - wenigstens der verarmte Rittmeister Waldner spricht kräftig dialektgefärbt, was seine Nähe zum Ochs von Lerchenau im themenverwandten «Rosenkavalier» unterstreicht. Bauhaus-Mobiliar und Kostüme sind den dreissiger Jahren verpflichtet - Wien war auch die Stadt Adolf Loos'. Da hausen in einem Hotel der dem Spiel und dem Alkohol verfallene Waldner, seine amourös arg vernachlässigte Gattin Adelaide, die sich auch mal einem der Buhler ihrer Tochter an die Brust wirft, und die Töchter Arabella und Zdenka, letztere bis zum Schluss als Zdenko drapiert. Mit dem Besuch des Waldbesitzers Mandryka kehrt nicht nur der künftige Schwiegersohn, sondern auch ein ruppiger Umgangston mit dem Personal ein - und Geld, das Vater Waldner sogleich verspielen wird. |
| Die zeitliche Transposition ist dem Stück nicht nur kein Nachteil, sondern gereicht ihm zum Vorzug: Sie entstaubt es und verschärft die Ungleichzeitigkeit der Kulturen - will doch Mandryka mit seinen bärenfellbehangenen Mannen allen Ernstes ein Duell veranstalten, um seine verletzt geglaubte Ehre zu retten. Die «Fiakermilli» erscheint im zweiten Akt nicht als jodelndes Alpenmaderl, sondern als singendes Revuegirl (Erika Niklósa), eine zweite Liza Minnelli im schwarzen Frack, den sie rasch ablegt, um vollends ihre Reize spielen zu lassen. Die erfahrene Hand des Regisseurs zeigt sich vorab in der Personenführung, die mit geradezu choreografischer Präzision die Figuren zeichnet, etwa die innere Unruhe der unentwegt trippelnden Zdenka, die selber in den Jägeroffizier Matteo verliebt ist, einen der Freier ihrer Schwester Arabella. |
| Sängerisch lockt die Zürcher Produktion mit klingenden Namen, vor allem dem der Titeldarstellerin Cheryl Studer. Allerdings bereitete die amerikanische Sopranistin nach ihrem strahlenden Auftritt im ersten Akt - grosse Stimme, weiter Atem, viel Kraft und Konzentration - spätestens im Schluss-akt eine leichte Enttäuschung: Ihr Gesang liess an rhythmischer Präzision und Tonhöhenpräsenz nach, die Stimme begann zu «schwimmen». Als stämmig-grobschlächtigen Mandryka erlebt man Wolfgang Brendel, als strahlenden Matteo mit herrlichem Heldentenor Piotr Beczala. Dawn Kotoski singt und spielt die Hosenrolle der Zdenka mit eng mensurierter, ungemein textverständlich geführter Stimme, und Cornelia Kallisch ist die auch sängerisch vorzügliche Mutter Adelaide. Alfred Muff hat, singschauspielerisch drastisch geführt, als Rittmeister Waldner eine Sternstunde seines Bass-buffo-Fachs. |
| «Arabella» ist oft mit dem «Rosenkavalier» verglichen worden und teilt mit ihm auch die Rückkehr zu einer oft terzen- und sextenseligen walzernden Tonalität. Chefdirigent Franz Welser-Möst legt mit dem Zürcher Opernhaus-orchester den Finger ebenso auf den typisch straussischen Schwung und das lodernde Feuer und treibt damit seine Sänger mitunter an ihre Grenzen. Dass in der Partitur auch viel Kitsch verborgen ist, wird von ihm mit Geschick überspielt. |

|
|
|