|
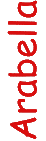
|

|
|
Neue Zürcher Zeitung, 9. Mai 2000
|
|
Marianne Zelger-Vogt
Klärung statt Verklärung
Richard Strauss' «Arabella» im Opernhaus Zürich
|
| Der Beitrag des Opernhauses zum 50. Todestag von Richard Strauss (8. September 1999) kommt reichlich spät. Aber «Arabella», die hier seit 1978 nicht mehr zu sehen war, ist ja selbst ein «verspätetes» Stück. Ende der zwanziger Jahre, kurz vor Beginn des Nazi-Regimes, liessen Strauss und Hofmannsthal in ihrem letzten Gemeinschaftswerk noch einmal die Kaiserstadt der untergegangenen Donaumonarchie auferstehen mit ihrem Adel, ihren Standesregeln, ihrem Müssiggang, ihrem Schönheitskult und ihrer Sinnenfreude. Aber es ist nicht mehr das barocke Wien der Kaiserin Maria Theresia wie im «Rosenkavalier», sondern das verwelkende, dekadente von 1860 die «Stadt der Medisance und der Intrige». |
| «Fast eine Operette» sollte die lyrische Komödie nach dem Willen ihrer Schöpfer werden, und dies impliziert nicht nur Leichtigkeit und Walzer-Klänge sondern auch bewusste Scheinhaftigkeit. Das Märchen hat zwar ein Happy-End: Die schöne Arabella findet im reichen krostischen Gutsherrn Mandryka den «Richtigen», den sie sich erträumt hat, ihre Familie entgeht im letzten Moment dem Ruin; doch ebensogut hätte das Täuschungsspiel um die als Jüngling ausgegebene jüngere Schwester Zdenka in die Katastrophe führen können. |
| Die Doppelbödigkeit, das Zweideutige sichtbar zu machen, die Scheinhaftigkeit aufzudecken, ist die Leitidee von Götz Friedrichs Inszenierung. Damit wird in der traditionslastigen Zürcher Rezeptionsgeschichte des Werks ein neues Kapitel aufgeschlagen: keine Demontage, aber doch ein beharrliches Infragestellen nach dem Motto «Lieber Banalisierung als Idealisierung». Die Verlegung der Handlung in die Entstehungszeit von «Arabella» verfälscht zwar den historischen Kontext, datür ermöglicht sie Gottfried Pilz und Isabel lnes Glathar, sich in ihrer Ausstattung der Neuen Sachlichkeit zu verschreiben: Ecken und Geraden statt weicher Rundungen und zierlicher Stukkaturen, ein buntes Gemisch von Kostümen statt aristokratischer Eleganz. All die geschwungenen Treppen, auf denen einst die «Arabellissima» Lisa Della Casa zu ihren Mandrykas niederschwebte - nur noch schöne Erinnerung. |
| Geschweift ist jetzt einzig die hellgraue Wand des Salons im Stadthotel, wo die Familie des Rittmeisters a. D. Graf Waldner in Ermangelung eines festen Heimes Quartier bezogen hat. Festsaal und Hotel-Entree (zweiter und dritter Akt) sind in glänzendem, kaltem Schwarz gehalten, wobei der Fiaker-Ball in einem mondänen Nachtklub stattfindet. |
| Diese nüchternen, gleichwohl ästhetischen Räume, deren Wände immer wieder transparent werden für die ferne Naturwelt Mandrykas, belebt Friedrich mit plastisch und farbig gezeichneten Figuren, manche eher traditionellen Zuschnitts - die drei Grafen Elemer (Peter Straka), Dominik (Cheyne Davidson) und Lamoral (Guido Götzen) sowie die Wahrsagerin (Irene Friedli) -, andere durchaus atypisch, so die schlaksige, stimmlich etwas magere Fiakermilli von Erika Miklosa, vor allem aber die weit mehr als exaltierte, nämlich egomanische, haltlose, dabei jedoch konzis singende Adelaide von Cornelia Kallisch. Unkonventionell auch deren Ehemann, der spielsüchtige Graf Waldner. Alfred Muff zeichnet ihn derb-jovial, als stamme er vom Baron Ochs auf Lerchenau ab, was sein (meist) wienerischer Tonfall noch unterstreicht. |
| Ungewöhnlich nicht so sehr durch sein Rollenprofil als vielmehr durch seinen vokalen Rang ist das Freundespaar Zdenko/Zdenka - Matteo, aus dem schliesslich ein Brautpaar wird. Dawn Kotoski findet in der Verkleidung als Jüngling eben so intensive, leidenschaftliche Töne wie als verliebtes Mädchen, und Piotr Beczala meistert mit seinem höhensicheren, substanzreichen Tenor die heikle Partie des von Arabella abgewiesenen Freiers so souverän, dass sie den Beiklang gequälter Weinerlichkeit verliert. |
| Doch das zentrale Paar sind natürlich Arabella und Mandryka. Und hier zeigt die Zürcher Inszenierung deutliche Defizite. Cheryl Studer agiert im ersten Akt, der Arabella «in der Schwebe» zeigt, fahrig und unruhig, als wolle sie die Gestalt in einzelne Wesenszüge zerlegen: kokett, stolz kindlich, mütterlich, lebenslustig und manchmai halt auch nachdenklich und ernst, alles eine Spur zu nachdrücklich. Erst im zweiten Akt, in der Begegnung mit Mandryka, entwickelt sich diese Arabella zu jener starken, in sich ruhenden Persönlichkeit, die sie von Anfang an sein müsste, doch da beginnen sich stimmliche Ermüdungserscheinungen bemerkbar zu machen. Das Timbre von Cheryl Studers Sopran bleibt zwar warm und lyrisch, die langgezogenen Phrasen sind schön durchgeformt, aber die Höhe klingt manchmal eng und flackrig, statt in echter Strauss-Manier aufzublühen, und das Farb- und Ausdrucksspektrum dieser Stimme erweist sich bald als allzu schmal. |
| Ein Mangel, an dem auch Wolfgang Brendels Mandryka krankt (mehr als an seinem eingebundenen Arm). Sein Bariton entwickelt zwar immer noch erstaunliche Fülle und Resonanz, aber er ist schwer geworden und unterschlägt die zarteren, helleren Zwischentöne. Nicht bloss ernst und stark wirkt dieser Mandryka, der in das verderbte Wien die klare Lebensluft seiner südslawischen Wälder und Felder tragen sollte sondern düster. Den Humor und den fast kindlichen Überschwang, die den Charme dieser Figur wesentlich begründen, vermittelt Brendel nicht. |
| Dass die Schlussszene ihren Zauber nicht voll entfaltet, ist alIerdings primär dem Regisseur anzulasten, der dem Prinzip der Desillusionierung auch hier treu bleibt. Wenn Mandryka seinen zukünftigen Familienmitgliedern Waldner und Matteo Banknoten zusteckt, wird daran erinnert, dass die Liebesheirat auch eine Geldheirat ist, und mit den zwei Putzmännern und der Fiakermilli bricht ins märchenhafte Happy-End vollends die Realität ein. - Bietet Friedrichs Inszenierung immer wieder Ansätze zu einer Neudeutung von Figuren und Szenen, die aber kein geschlossenes Ganzes ergeben, so präsentiert sich das musikalische Erscheinungsbild des Werkes wie aus einem Guss. |
| Der Dirigent Franz Welser-Möst lässt die Melodien organisch ineinanderfliessen, ohne dass sie zerfliessen, er hält das musikalische Geschehen in natürlichem Fluss, ohne ihm Momente der Ruhe und der Verdichtung zu verweigern, und er macht das komplexe Motivgeflecht jederzeit transparent. Anders als auf der Bühne erhält hier das Wechselspiel von Hell und Dunkel feinste Schattierungen, und das Orchester macht der Zürcher Strauss-Tradition alle Ehre. |
| © AG für die Neue Zürcher Zeitung NZZ 2000. Gli articoli della NZZ sono pubblicati con il consenso scritto della testata zurighese. |

|
|
|