|
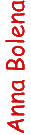
|

|
|
Tages Anzeiger, 4. April 2000
|
|
Susanne Kübler
Die Karrieristin und die Heilige
|
| Ein düsterer Raum, zwei starke Frauenstimmen und viele Kniefälle bestimmen Gaetano Donizettis «Anna Bolena» im Zürcher Opernhaus. |
| Die Meisterin des Bühnen-Wahnsinns ist in ihrem Element. Wie als Protagonistin in Donizettis «Lucia di Lammermoor», wie als Königin Elisabetta in seinem "Roberto Devereux" singt sich Edita Gruberova auch als Anna Bolena höchst virtuos um den Verstand. Mit kleinen, irren Schlenkern in der Stimme, einem unwirklich leisen Pianissimo und schrillen Ausbrüchen. Dazu der starre Blick, das nervöse Kopfzucken, die mädchenhaften Posen, in denen sie sich kurz vor ihrer Hinrichtung in eine glückliche Vergangenheit zurückträumt: Dieser Wahnsinn ist bis ins letzte Detail kalkuliert und wirkt gerade deshalb so unheimlich. |
|
Historische Rivalinnen
|
| Niemand engagiert sich vehementer als Edita Gruberova für diese Oper, die 1830 Donizettis internationalen Ruhm begründet hat. Und die Rolle der Anna Bolena scheint ihr tatsächlich in die Stimmbänder komponiert zu sein. Während ihre zurückgenommenen Spitzentöne und die kunstvoll kontrollierten Schleifer sonst gelegentlich manieriert wirken können, begleiten sie hier den Rückzug der Protagonistin aus der Wirklichkeit. Das ist umso überzeugender, als Vesselina Kasarova als ihre Hofdame und Rivalin Giovanna Seymour einen ganz anderen Ton pflegt; mit ihrem dunklen, temperamentvollen Mezzosopran ist sie eine starke Gegenspielerin Gruberovas. Wie ideal sich die beiden ergänzen, zeigt sich bei Giovannas Geständnis, die neue Geliebte des Königs und damit der Grund für die tödliche Intrige gegen Anna zu sein: Klanglich und darstellerisch treffen sich die zwei Frauen auf dem schmalen Grat zwischen Eifersucht und Verzeihen, Verletztheit und Liebe, Loyalität und Hass. |
| Die berührende Szene spielt wie alle anderen in einem düsteren, hohen Raum (Bühne: Mark Väisänen). In diesem Moment ist er mit prunkvollen, aber blinden Spiegeln vollgestellt; in anderen bietet er einen Ausblick ins Freie oder wird zur Bibliothek. Vor allem aber ist er ein Treffpunkt von Menschen aus unterschiedlichen Zeiten. Anna Bolena und Giovanna Seymour treten in historisch inspirierten Roben auf (Kostüme: Maria-Luise Walek). Annas Tochter Elisabetta, die Regisseur Gian-Carlo del Monaco als stille Beobachterin eingeführt hat, weist dagegen mit steifem Kragen und hoher Stirn auf die damalige modische Zukunft voraus; gleichzeitig stellt sie den Bezug her zu del Monacos Zürcher Inszenierung von Donizettis «Roberto Devereux» von 1997, in der Edita Gruberova als Königin Elisabetta entsprechend aufgemacht war. |
|
Moderner Bösewicht
|
| Der Mann zwischen Anna Bolena und Giovanna Seymour schliesslich stammt aus dem zwanzigsten Jahrhundert. László Polgár als König Enrico VIII. wäre mit schwarzem Hut, schwarzem Mantel und seiner wohlklingend schwarzen Stimme, mit dem goldbeknauften Stock und der Sonnenbrille in jedem TV-Krimi als Übeltäter zu erkennen. Vielleicht soll damit die Zeitlosigkeit des Bösen betont werden, vielleicht auch die unüberwindbare Distanz zwischen Frauen und Männern: Es spielt letztlich keine Rolle, denn die Vermischung der Zeitebenen hat keinerlei inhaltliche Konsequenzen. |
| Auch die anderen Brüche, die Gian-Carlo del Monaco in Szene setzt, wirken vor allem dekorativ. Der naive Realismus des blühenden Frühlingsbaumes am Anfang steht den symbolischen Ketten der Kerkerszene gegenüber, die Suche nach musikalischer Unmittelbarkeit kontrastiert mit einer Personenführung, die kaum konventioneller sein könnte. Man geht nicht in dieser Inszenierung, man schreitet; und Reinaldo Macias taumelt als Annas Jugendliebe Percy von einem Kniefall in den nächsten. |
| Dieser Stilmix wirkt höchst artifiziell. Und eigentlich passt er ganz gut zu dieser Oper, die durchaus etwas Künstliches hat. Der Librettist Felice Romani hat die verwickelten historischen Begebenheiten in ein strenges schwarz-weisses Raster eingepasst; der König ist bei ihm durch und durch böse, Giovanna Seymour eine reuefähige Karrieristin und Anna Bolena eine Heilige, die noch nach ihrem Todesurteil rundherum allen mit fast penetrantem Grossmut verzeiht. Auch musikalisch sind sie eher Prototypen als Menschen. Sinistre Streicher-Akkorde oder ein gelegentlich harsches Rumpeln in den Bässen, vom Opernhaus-Orchester unter Paolo Carignani prägnant, wenn auch nicht immer ganz präzis ausgespielt, sind erst einzelne Vorboten einer späteren psychologisierenden Tendenz in der italienischen Oper. |
|
Alles nur Theater
|
| Dennoch hat man den Eindruck, dass die Künstlichkeit in dieser Aufführung weniger Konzept ist als ganz einfach die simpelste Lösung für ein ernsthaftes Regieproblem. Dass es nach den blühenden Bäumen und dem Herbstlaub auf dem Boden in den letzten Bildern schneit, ist zwar einleuchtend, aber auch etwas billig. Und dass die Puppe, die die kleine Elisabetta mit den wechselnden Kostümen der Mutter einkleidet, nach dem Todesurteil keinen Kopf mehr hat, war ebenfalls zu erwarten. Man kann der Inszenierung die innere Logik nicht absprechen; spannungslos ist sie trotzdem. |
| Nun ist die Frage, wie ein solches Werk heute auf die Bühne gebracht werden könnte, durchaus nicht einfach zu beantworten; das gleichmässig bedächtige Erzähltempo und die umständlichen Formulierungen der Gefühle sind vorgegeben. Heikel ist aber, dass del Monaco dieser Frage mit einem Trick von vornherein ausgewichen ist: Der Chor sitzt - als weitere der zahlreichen Referenzen zum Zürcher "Roberto Devereux" - in Opernlogen, die sich jeweils in den Wänden auftun. Damit wird die Bühne als Bühne gezeigt, die traditionellen Kniefälle müssen als Operngesten gar nicht erst hinterfragt (und auch nicht wirklich gestaltet) werden. Den Versuch, etwas Echtes, Aktuelles, Lebendiges aus diesem Theaterstück herauszuholen, hat der Regisseur mit seiner Betonung der Künstlichkeit garnicht erst unternommen. |

|
|
|