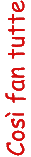 |
 BASLER ZEITUNG BASLER ZEITUNG
|
|
Basler Zeitung, 22. Februar 2000
|
|
Sigfried Schibli
Auch die Mozartschen Längen
können himmlisch sein
Opernhaus Zürich: Flimm und Harnoncourt
erarbeiten Mozarts Oper «Così fan tutte»
|
| Sie war Despina, sie war Dorabella, nun ist sie Fiordiligi: Cecilia Bartoli hat die Stufenleiter der Frauenrollen in Mozarts Oper «Così fan tutte» erklommen und im Vollbesitz ihrer stimmlichen Kräfte an der Zürcher Oper erstmals die höhere Schwesternpartie dieser Mozartoper gesungen - im Wissen, dass ihrem Stimmprofil «eigentlich» die dunklere Doraballa entspräche. |
| Das Experiment, das für die vorsichtige Sängerin gewiss keines ist, wurde von Erfolg gekrönt: «La Bartoli» singt die Sopranpartie der Fiordiligi, wie wenn sie sie schon immer gesungen hätte - souverän in den Koloraturen, stets mit einem lodernden emotionalen Feuer in der Stimme, präzis bis in die Spitzentöne, kraftvoll in der brustigen Tiefe und mit jener Bandbreite zwischen tonlos gehauchten, bedrohlich gurrenden und trompetenartig gestossenen Tönen, die ihr so leicht keine Sängerin nachmacht. |
|
Prima und Seconda Donna
|
| Dass ihre grosse E-Dur-Arie «Per pietà ben mio» im zweiten Akt zu einem Höhepunkt der Aufführung wird, verdankt sich nicht nur der ungemein differenzierten Begleitung, sondern auch Cecilia Bartolis Kraft zum Ausloten der emotionalen Grenzbezirke. Eine Kraft, die nur den einen Nachteil hat, die Dorabella klar auf den zweiten Platz zu verweisen - und dies, obwohl Liliana Nikiteanu die Partie der draufgängerischeren Schwester Fiordiligis mit viel Musikalität, Anmut und auch Theatralik ausstattet. Ein Wagnis ist die Besetzung der Zofe Despina durch die griechische Mezzosopranistin Agnes Baltsa, die so wenig das «Mädchen» verkörpert wie Don Alfonso den «Greisen» (1. Akt, 10. Szene). Ihre Wandlung von der ahnungslosen Beobachterin zur Drahtzieherin des Menschenversuchs wird nicht glaubhaft, und Baltsas schneidend scharfe rabiate Stimme sticht unangenehm aus dem Ensemble hervor. Carlos Chausson als Don Alfonso: ein relativ junger, stimmlich nobler, aber nicht sehr belastbarer professoraler Zyniker. Am liebsten hält er sich am Bühnenrand auf und schaut teilnehmend zu. Don Alfonso ist der Auslöser eines inszenatorischen Einfalls, der als kongenial zu bezeichnen ist: Mozarts Oper «Così fan tutte» als Gegenstand einer Vorlesung in angewandter Psychologie, gehalten vom Professor Don Alfonso als abgeklärt-weisem, aber auch menschenverachtendem Versuchsleiter, mit den jungen Paaren Fiordiligi/Guilelmo und Dorabella/Ferrando als Versuchspersonen auf dem Prüfstand der vorehelichen Treue. Doch die Thesen des Wissenschaftlers («Infidelitas propria feminis ist») finden nicht nur Zustimmung: Unter den Studenten, die stumm um das Katheder herum sitzen, melden sich zwei sehr eifrige zu Wort, um sich für ihre Frauen in die Brust zu werfen und für die Treue ihrer Mädchen durchs Feuer gehen würden. Die Beiden riskieren gar - und welche Sprache wäre objektiver als die des Geldes? - eine Wette mit dem Professor. |
Guilelmo (vokal höchst beweglich, mit Spielwitz und prächtiger baritonaler Substanz: Oliver Widmer) tut, als begehrte er Dorabella und entreisst ihr gar das Schmuckbild Ferrandos; dieser (Roberto Saccà mit strahlendem klar geführtem Tenor) braucht mehr seelischen Erpressungsaufwand, um die standhafte Fiordiligi vom Partnertausch zu überzeugen («Barbara! Perchè fuggi?»), sieht sich aber mit Guilelmo verfrüht als Wettsieger. Der Rest ist bekannt: Fiordiligi und Dorabella sind nach anfänglichem Zögern nicht nur bereit, sich auf einen Ferienflirt einzulassen, sondern bringen es dank Don Alfonso und Despina bis zur Hochzeit. «Così fan tutte (le donne)», meinten die Männer Mozart und da Ponte.
|
| Selten erlebte man den Anfang der Oper um Partnerschaft und Treuebruch - Mozart hatte ihr einst den Untertitel «Scola degli amanti» gegeben - so plausibel wie jetzt am Zürcher Opernhaus durch Jürgen Flimms Regie. Der Hörsaal gleicht einer Arena (Bühne Erich Wonder), in der die zarte Liebe den wilden Trieben vorgesetzt und gnadenlos von diesen zerfetzt wird. Die chronologische Inkonsequenz, dass die Kostüme (Florence von Gerkan) aus dem 19. Jahrhundert sind und der Hellraumprojektor im Hörsaal aus dem 20., wäre hinzunehmen; auch, dass Ferrando die Sache nicht ganz ernst nimmt und einen Cancan hinlegt, als wäre er in einer Offenbach-Operette («Una bella serenata...»). Schwerer wiegt, dass Flimm seine Ursprungsidee rasch aufgibt und die Oper in kitschfarbene postmoderne Beliebigkeit überführt. Da gibt es halb verhüllte, aber nur allzu durchsichtige Szenenwechsel etwa vom Hörsaal zum Meergestade, plumpe Kulissenschiebereien, unsinnige Gänge (zum Abschiedsquintett schlendern die Mädchen klammheimlich an die Rampe) und den Rückfall in einen überwunden geglaubten Buffastil, in dem erwachsene Italiener sich türkisch drapieren und eine Kammerzofe den dicken Anwalt mimt. Schlimmster Opernstil, verstaubt und verzopft. |
|
Mozart durch Schuberts Brille
|
| Ein Lichtblick ist das Dirigat von Nikolaus Harnoncourt, der die Emotionen in jedem Takt ernst nimmt und damit zu packenden Ergebnissen kommt. Von ungewohnter Gepresstheit und schönem Sehnsuchtston ist schon die mit knackigen Hörnern aufwartende Ouvertüre. Sein Hang zum Verdeutlichen der Struktur (Sextett im ersten Akt) und zur Spreizung der Tempi (romantisierend langsames «Addio») mag nicht selten übertrieben wirken; doch ist es klar Harnoncourt und nicht die Regie, welcher die Spannung dieser Produktion bis zuletzt aufrecht erhält. |

|
|
|