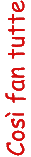 |

|
|
Neue Zürcher Zeitung, 22. Februar 2000
|
|
Peter Hagmann
Traurige Probe, schauriges Exempel
«Così fan tutte» von Mozart im Opernhaus Zürich
|
| Ob es tatsächlich alle so machen - alle Frauen nämlich? Lorenzo Da Ponte behauptet es, und er sah sich unterstützt von Wolfgang Amadeus Mozart. Das war 1790 und ist schriftlich überliefert, weshalb in der neuen Produktion von «Così fan tutte» am Opernhaus Zürich, wenn sich nach drei langen, durchgehend spannenden Stunden der Vorhang schliesst, Don Alfonso ein letztes Mal sein Büchelchen in die Höhe hebt. Gelehrter ist er, Intellektueller mit Lesebrille - und Menschenverächter, das kann man sagen, auch wenn sich der Zynismus bei Carlos Chausson und seinem relativ hellen Bariton in Grenzen hält. Um nichts anderes als einen Versuch am offenen Leib geht es ihm, um einen Menschenversuch, und von hier ist es nicht weit bis zu jenem Hörsaal, den der Bühnenbildner Erich Wonder mit um so mehr Berechtigung erbaut hat, als sich Mozarts Oper im Untertitel «La scuola degli amanti» nennt. Ein weisser Kubus erscheint da anfangs; am Ende, wenn das Experiment misslungen und jedes Gefühl zwischen den Patienten zerstört ist (leise rieselt dann der Schnee), erweist er sich als der Käfig, in dem die Versuchskaninchen zur Schau gestellt werden. |
| Dass das Experiment misslingen muss, weil die Versuchsanordnung ausser Kontrolle gerät und Don Alfonso zum Zauberlehrling wird, das zeigt die Zürcher Inszenierung, der Abschluss eines neuen Mozart-Da-Ponte-Zyklus, mit aller Brutalität. Äusserlich ist das Spiel klar als Opera buffa angelegt; hier ein Sprachwitz (die Verständlichkeit liegt bemerkenswert hoch), dort ein Szenenwitz (das Ensemble agiert wunderbar leichtgewichtig), und manchmal gibt es gar eines jener Witzchen, die der Regisseur Jürgen Flimm so sehr zu lieben scheint. In Wirklichkeit wird «Così fan tutte» jedoch als eine hochemotionale und tieftraurige Geschichte gezeigt - und das geht in erster Linie auf den Dirigenten Nikolaus Harnoncourt zurück. Radikal geht er zur Sache, weit radikaler als 1986, im Rahmen des gemeinsam mit Jean-Pierre Ponnelle konzipierten Zürcher Mozart-Zyklus, radikaler auch als in der Amsterdamer CD-Aufnahme von 1991. Sehr weich der Klang und gleichzeitig enorm zugespitzt die Expressivität. Womit nicht nur unterstrichen wird, in welchem Mass die Musik bei «Così fan tutte» als Subtext zum Geschehen eingesetzt ist, sondern auch bewusstgemacht wird, wie sehr das Stück ästhetisch ins frühe 19. Jahrhundert blickt. Seine Verlängerung findet dieser Ansatz in den Kostümen, für die sich Florence von Gerkan an der Bekleidung des aufkommenden Bürgertums orientiert hat. |
| Nicht gerechnet hat Don Alfonso damit, dass die beiden Frauen, denen er - den Vorstellungen einer durch die Französische Revolution entthronten Gesellschaftsschicht gemäss - Flatterhaftigkeit unterstellt, das Spiel für Ernst halten, das Heft in die Hand nehmen und sich aktiv in die vom Drahtzieher geschaffene Situation einmischen. Wenn Dorabella mit ihrer Schwester auf die Bühne tritt, ist Liliana Nikiteanu, die hier einen grossen Abend erlebt, noch ganz Püppchen; hat sie dann aber Morgenluft gewittert, schreitet sie zur Tat: entscheidet sie sich für den anderen und wickelt ihn sich zielstrebig um den Finger. Fiordiligi tut sich da schwerer. Sie erscheint als eine still in sich gekehrte, schwerblütige, nur selten, dann aber heftig aufbrausende Person. Wunderbar, mit welcher Vielfalt des sotto voce Cecilia Bartoli, die diese Partie zum erstenmal singt, das zum Ausdruck bringt; und dass sie an der Premiere aus dem Publikum mit einem verärgerten «voce» dafür gescholten wurde, darf sie als Kompliment verbuchen. Zum Höhepunkt des Abends wird ihre grosse Arie «Per pietà» im zweiten Akt, die sie, zusammen mit Harnoncourt und dem hellwachen Orchester, ganz und gar extrem nimmt: gedehnt, gehaucht, eine Grenzerfahrung, dass man meint, das Herz müsse stillstehen. |
| Ebensowenig gerechnet hat Don Alfonso damit, dass den beiden Männern das Temperament derart durchgeht. Nur zu gern lassen sich die beiden Studenten auf den Vorschlag ihres Professors ein: der buffonesk sinnenfreudige Guglielmo, den Oliver Widmer mit wohlfundierter Sonorität ausstattet, und der etwas vornehmere Ferrando, für den sich Roberto Saccà mit einem Optimum an tenoralem Schmelz einsetzt. Besitzerstolz und Selbstgewissheit lassen sie im ersten Akt noch nicht richtig aufs Spiel eingehen, und selbst wenn sie schon in Verkleidung auftreten, richten sie ihre Werbungen noch immer an ihre eigenen Geliebten statt an die je andere Partnerin - die Entscheidung fällt eben bei den Frauen. Ist sie dann freilich gefallen, geraten die Herrschaften ordentlich in Fahrt, allerdings weniger um der Frauen willen als einfach im Versuch, dem anderen die Geliebte auszuspannen und ihn in seiner Männerehre zu treffen. Machos sind sie beide; am Ende liegen sie verwundeten Tieren gleich am Boden. Così fan tutti, was zu beweisen Don Alfonsos Absicht nun allerdings nicht war. |
| Und dann: Despina, gesungen - nein: mit Leib und Seele über die Rampe gebracht von Agnes Baltsa. Auch dies ein Rollendébut, ein geradezu sensationelles und ein eigenartig anregendes dazu. Gewiss, ihr Registerbruch tritt auch hier heftig zutage, auch wenn er besser kontrolliert scheint als bei anderen Auftritten. Und dass sie die mittleren und leiseren Bereiche aus ihrem Ausdrucksspektrum gestrichen hat, dass sie fast durchwegs laut und in jenem flächigen Legato singt, das dem sprechenden Ausdruck Harnoncourts widerspricht, über das lässt sich nicht hinweghören. Aber dass Despina, im Text als ein Mädchen von fünfzehn Jahren charakterisiert, von einer lebenserfahrenen, bisweilen gar ein wenig mütterlichen Frau verkörpert wird, verleiht dieser Partie eine ganz ungewöhnliche Farbe und bringt einen erheiternden Bruch ins Geschehen. Da sind wir, quasi durch die Hintertür, wieder beim Dramma giocoso, als das «Così fan tutte» konzipiert ist. Und zugleich wird, als Kontrastfolie zur Empathie, die im Musikalischen herrscht, das Spiel als Spiel gezeigt. Als Gedankenspiel vielleicht, jedenfalls als eine traurige Probe aufs schaurige Exempel, wie sie Büchern zu entnehmen ist. |

|
|
|