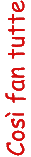 |
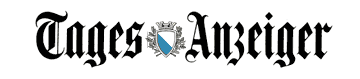
|
|
Tages Anzeiger, 22. Februar 2000
|
|
Susanne Kübler
Wenn das Drama im Kitsch aufgeht
|
| Nikolaus Harnoncourt und Jürgen Flimm präsentieren am Zürcher Opernhaus «Così fan tutte» als letzten Teil ihrer Mozart-Trilogie. Musikalisch hinreissend, geometrisch eigenwillig. |
| Zunächst wird der Kampf mit Kreide geführt, in einem anonymen Hörsaal der «scuola degli amanti«, die Mozart in den Untertitel von «Così fan tutte» setzte. In schnörkelig-schwungvollen Lettern und ehrwürdigem Latein hat Don Alfonso die Gesetze von der Untreue der Frauen auf der Tafel festgehalten, weiss auf schwarz schmieren Ferrando und Guilelmo ihre Gegenargumente darüber: die vornehme Erziehung, die Schwüre und die Charakterstärke ihrer Geliebten. Damit sind die Positionen bezogen, Don Alfonso kann seine Intrige beginnen und wie einen mathematischen Beweis durchführen, bis am Ende die Frauen übers Kreuz auf ihre verkleideten Verehrer hereingefallen sind. |
|
Drahtzieher Harnoncourt
|
| Wie sehr dieses betont theoretische Experiment ans Lebendige geht, wird allerdings bald klar: Nicht nur, weil die Kreidestücke mit Schwertern vertauscht werden, die weiblichen Forschungsobjekte in besinnungsloser Rage Stühle umtreten und vor Verzweiflung fast hyperventilieren. Es ist vor allem die Musik, die sehr schnell existenzielle Dimensionen erschliesst. |
| Nikolaus Harnoncourt erweist sich im Orchestergraben als ebenso verlässlicher wie einfallsreicher Komplize von Don Alfonso: Er kommentiert das Nein der Frauen gegenüber ihren verkleideten Verehrern mit einem musikalischen Vielleicht und formuliert ihr Ja dann zur Bedrohung um; er dehnt Pausen zu Peinlichkeiten, macht aus Wechseln des Tempos solche der Gesinnung. Unter seiner hellwachen Leitung wird das Orchester der Oper zum Kontrahenten und Verbündeten des Bühnenpersonals. So wirkt es nur natürlich, wenn Don Alfonso sein Vergnügen am Intrigieren auch einmal mit dem Cembalisten teilt. |
| Takt für Takt scheint Harnoncourt die Musik auf ihre Doppelbödigkeit abgeklopft zu haben, mit jener Gründlichkeit und Fantasie, mit der er schon in den ersten beiden Opern von Mozart und Lorenzo da Ponte für musikalische Frische besorgt war. Hier hat er nun nicht nur die Konsequenz zu Tage gefördert, mit der Mozart den Text umsetzte, sondern auch die offenen Momente, die Zweideutigkeiten und Zweifel. Und der Regisseur Jürgen Flimm hat ein offenes Ohr für diese Finessen: Aus ihnen heraus ändert er die traditionelle Geometrie der Handlung, ohne dem Text zu widersprechen. So umwerben in seiner Version die verkleideten Galane zunächst ihre «richtigen» Verlobten; es sind die Frauen, die sich dann explizit für den jeweils anderen entscheiden. Was den Katzenjammer der beiden Verführer noch beträchtlich erhöht. |
|
Atemberaubend hysterisch
|
| Flimm zeigt die Entwicklungen der Gefühle in jedem Schritt und jedem Blick; eine halbe Kopfbewegung kann genügen, um eine komplette Kehrtwendung anzuzeigen. Das funktioniert, weil er exzellente Sängerinnen und Sänger zur Verfügung hat, die gleichzeitig auch lustvoll schauspielern; allesamt können sie umwerfend komisch, traurig, wütend oder verliebt wirken. Carlos Chausson als Don Alfonso und Agnes Baltsa bei ihrem Rollendebüt als Despina intrigieren virtuos und unterstützen ihre Absichten notfalls auch mit einer guten Dosis Metall in den Stimmen. Oliver Widmer als Guilelmo schafft es, sogar musikalisch zu weinen, während Roberto Saccà noch im Moment seiner Niederlage standhaft lyrisch bleibt. Cecilia Bartoli gibt ihre erste Fiordiligi innig, zornig und in herzlichem Einvernehmen mit Liliana Nikiteanu, die als Dorabella nach der vermeintlichen Abreise ihres Geliebten einen wunderbaren hysterischen Anfall produziert: Mit lodernder Stimme rast sie durch die Harmonien, als ob sie die melodische Kurve immer erst im letzten Moment schaffen würde, und schnappt bei ihrem «de'-miei-so-spir» Silbe für Silbe nach Luft. Atemberaubend, auch fürs Publikum. |
| Diese Verbindung von musikalischer Dramatik und dramatischer Musikalität würde auch auf einer leeren Bühne durch den Abend tragen. Für ein solches Ensemble hätte sich Flimm hemmungslos jeden beliebigen Rahmen für die Geschichte ausdenken können: historisch oder aktuell, abstrakt oder konkret. Abgesehen von seiner Idee der «scuola» hat er sich allerdings weitgehend aufs Bewährte verlassen. Die beiden Liebhaber begnügen sich wie in irgendeiner geradeaus gestrickten Inszenierung mit Turbanen und aufgeklebten Schnäuzen zur Verkleidung, Despina als Arzt erhält eine falsche Nase (Kostüme: Florence von Gerkan). |
|
Gefangen im Schneewürfel
|
| Die Zeitraffereffekte, mit denen Flimm in «Le Nozze di Figaro» und «Don Giovanni» die Zeitlosigkeit der Konflikte betont hat, kommen hier nicht mehr vor. Und Bühnenbildner Erich Wonder kann sich nicht recht entscheiden zwischen realistischen Elementen und einer Seelenlandschaft, die gleich hinter dem Hörsaal beginnt: als riesige Welle, die alle Überzeugungen davonschwemmt, als exotische Landschaft der Sehnsucht oder als Garten voller Kerzen. Viele Bilder sind es, die sich da überblenden und verschieben, abwechseln und durchdringen. Zu viele, und nicht alle passen. Warum immer wieder Fenster, Wände, Gänge eingeschoben werden, bleibt schleierhaft. |
| Erst gegen Ende gewinnt die optische Opulenz eine ganz eigene Dynamik, indem sie bewusst und unmissverständlich jedes Mass verliert. Für die (falsche) Trauung werden verschneite Bäume, ein ebenfalls verschneites Rehkitz und ein Vogel Strauss hereingetragen und um einen festlichen Tisch gruppiert. Ernüchtert und konsterniert setzen sich die Paare nach der Auflösung der Intrige in den originalen Kombinationen hin; vor lauter Scham scheinen sie den Glaswürfel, der sich mit einem heftigem Schneegestöber über sie senkt, gar nicht zu bemerken. In diesem Würfel sitzen sie dann und besingen freudlos ihre Versöhnung: gefangen in ihrer simpel-komplizierten Viereckskonstellation, verewigt als Anschauungsobjekt für lernwillige Studenten, die auf den Hörsaalbänken wieder aufgetaucht sind, vor allem aber durcheinander gewirbelt wie in einem Kinderspielzeug. Das Drama ist im Kitsch aufgegangen, die Maskerade hat exakt im Moment ihres Abschlusses das Höchstmass an Künstlichkeit und Absurdität erreicht. Man ahnt, dass dieser Schneewürfel auch in Zukunft noch herzhaft weitergeschüttelt wird. |
Mit gezücktem Schwert und vokaler Urgewalt widersetzt sich
Cecilia Bartoli den Avancen von Roberto Saccà. |

|
|
|